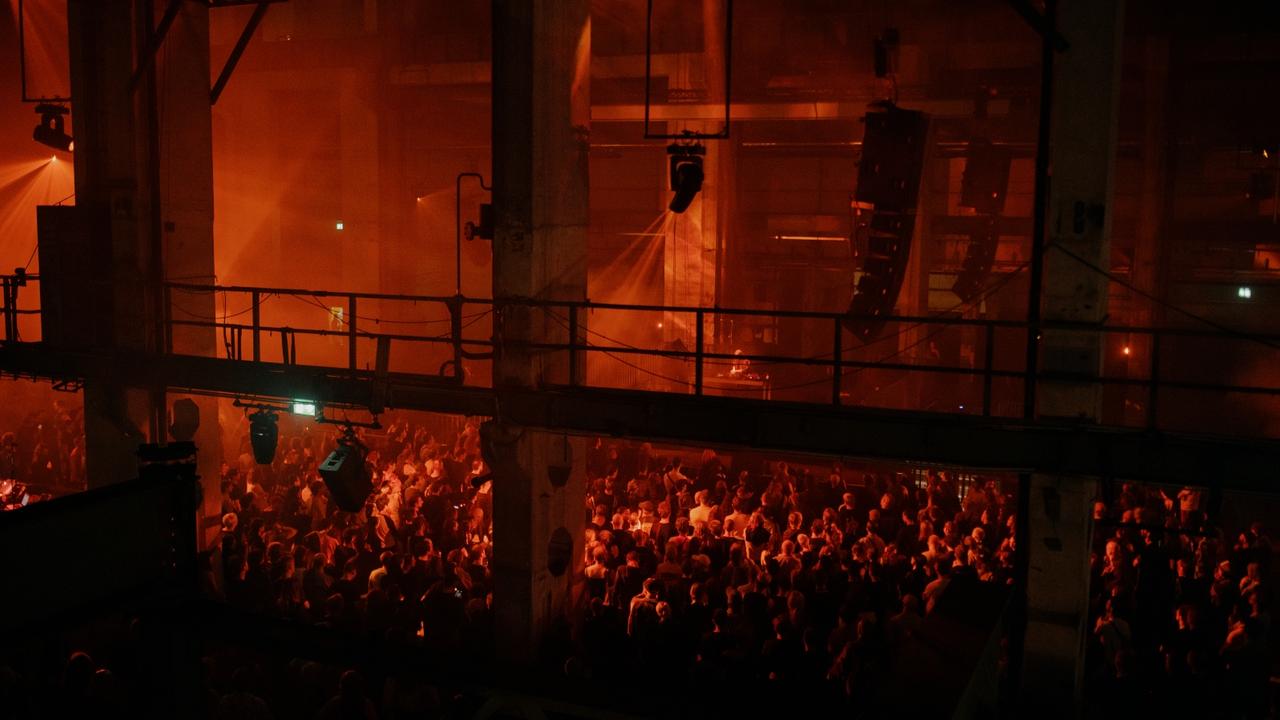Pageturner – September 2025: Exit-StrategienLiteratur von Gabriel Bump, Gudrun Lerchbaum und Molly McGhee
1.9.2025 • Kultur – Text: Frank Eckert, Montage: Susann Massute
Raus. Aufhören. Neu starten. In seiner Kolumne beleuchtet Frank Eckert ganz unterschiedliche Exit-Strategien. Vom Rückzug in einen Bunker über Pilzsporen, die das Lebensende zum Erkenntnis versprechenden Trip machen bis zu einem obskuren Job-Angebot, das so nur im wirklich sehr späten Spätkapitalismus denkbar ist.
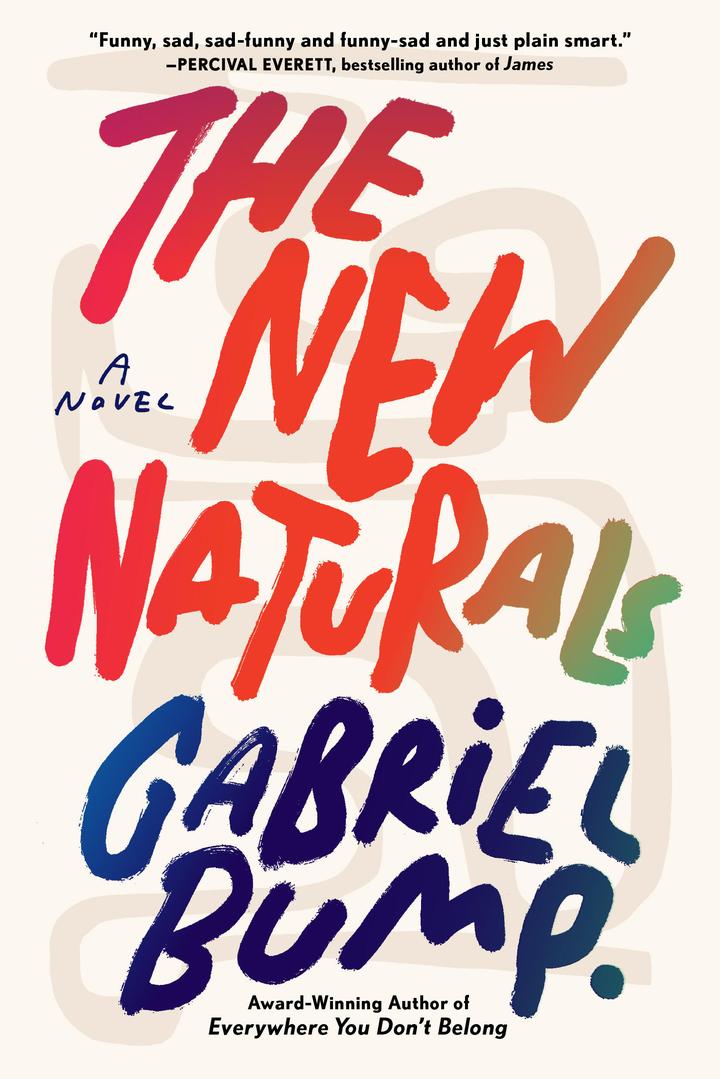
The New Naturals (Affiliate-Link)
Gabriel Bump – The New Naturals (Algonquin Books, 2023)
Wo Utopia genau liegt, war lange unbekannt. Nun wissen wir: in Massachusetts, in einem Bunker. Dorthin zieht es eine hochgradig diverse Gruppe desillusionierter und marginalisierter Menschen, die kaum mehr gemeinsam haben als die Erfahrung von Ablehnung, Ausgrenzung und Enttäuschung. Eine neue Gesellschaft, kein bisschen weniger, soll da entstehen, vollständig autark, ohne den Druck von Rassismus, Sexismus, Kapitalismus und Klimawandel, egalitär und inklusiv. „The New Naturals“ eben.
Gabriel Bump verbringt den größten Zeil seines zweiten Romans damit, klarzustellen, dass es kein besonders hartes Schicksal, aber auch keine außergewöhnlich strikte Radikalität braucht, um eine neue Gesellschaft, einen Neustart des Lebens zu wollen. Es sind weitgehend ausgeglichene, meist gut ausgebildete und sozial integrierte Menschen, die von dem Projekt angezogen werden. Darunter auch eine offensichtlich von ihrem Leben gelangweilte milliardenschwere Sponsorin, was die Durchführung des Projekts wie von selbst gehen lässt.
Es ist kein Spoiler zu verraten, dass es schief geht, aber warum und wie es schief geht unterscheidet Bumps Roman von so ziemlich jeder anderen Bunker/Aussteiger-Dystopie, die je geschrieben wurde. Es läuft ohne Trauma und Gewalt ab, man geht einfach getrennte Wege und versucht etwas anderes. Ein spekulativer Roman ist „The New Naturals“ nicht einmal im weitesten Sinn. Die Dynamik der Bunkergesellschaft, die technischen oder sozialen Gegebenheiten interessieren den Roman kein bisschen. Sowieso spielt nur eine Handvoll Seiten tatsächlich im Bunker. Ausführlich feingezeichnet dagegen die inneren Verwundungen und Enttäuschungen der erzählenden Charaktere: Wie die Summe scheinbar belangloser kleiner Beleidigungen und Zurückweisungen sogar gänzlich „normale“ Leute dazu bewegen könnte, in einen Bunker zu ziehen (zugegeben in einen recht luxuriösen, mit sorgfältig kuratierter Bibliothek) und einen radikalen Neuanfang zu wagen, der aber vielleicht so radikal und neu gar nicht ist.
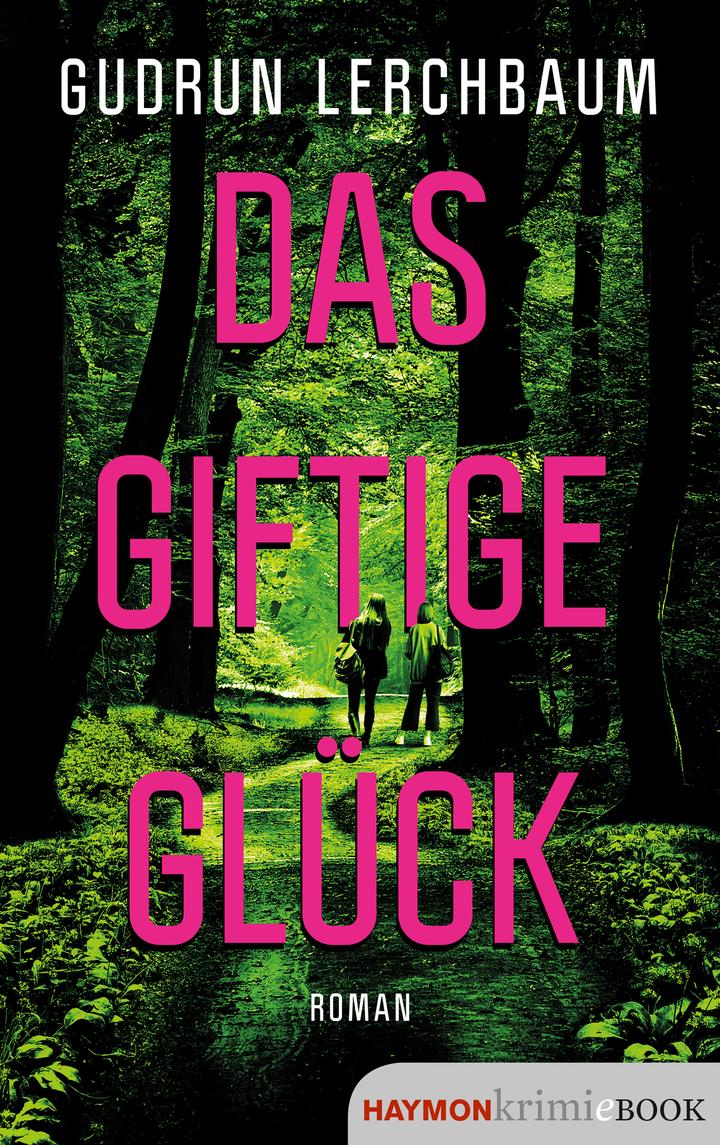
Das giftige Glück (Affiliate-Link)
Gudrun Lerchbaum – Das giftige Glück (Haymon, 2022)
Wird die Mykologie uns retten und unser Untergang? Pilze beherrschen die Welt und werden die Menschheit wohl überleben. Umgekehrt gilt das nicht unbedingt, jedenfalls schonmal nicht für die Schimmelkulturen, welche in Gudrun Lerchbaums schönen, kleinen, morbiden Gesellschaftsthriller den Wiener Bärlauch befallen. Dessen Sporen sind nicht nur zuverlässig tödlich, sie bescheren zudem den ultimativen Trip, ein Sterben an einer Überdosis Glückseligkeit. Eine tolle neue Exit-Option also für die unheilbar Kranken, für die Dementen und Lebensmüden? Oder eine einfache Einstiegsdroge für potentielle Mörder und Racheengel?
Ganz so einfach ist es aber in keinem der Fälle. Weder geht der simple Plan für die an MS im Endstadium erkrankte Olga auf, noch für ihre Pflegerin Kiki, die den Stoff besorgen soll. Und Jasse/Jasmin, ein vernachlässigter wütender Teenager, der Kiki neben und zwischen traumatisierten Gartenarbeiter:innen, zornigen Wachmännern, aufgebrachten Umweltschützer:innen, Schimmelleugner:innen und Deep-StateVerschwörer:innen im Park beim Bärlauchpflücken begegnet, hat noch nicht mal einen konkreten Plan mit dem „Viennese Weed“. So kommt es erwartbar anders als gedacht, das giftige Glück findet ganz andere Ziele. Was aus der Konstellation dann hervorgeht, ist eine fragile Solidargemeinschaft einer Handvoll Beschädigter, die mit den unerwarteten mykologischen Möglichkeiten einen neuen Weg des Umgangs mit dem Tod finden. Das ist dann schon eine sehr Wienerische (also in aller Morbidität immer unterhaltsame und mitunter lehrreiche) Weise, mit dem Tode zum Leben zu kommen.
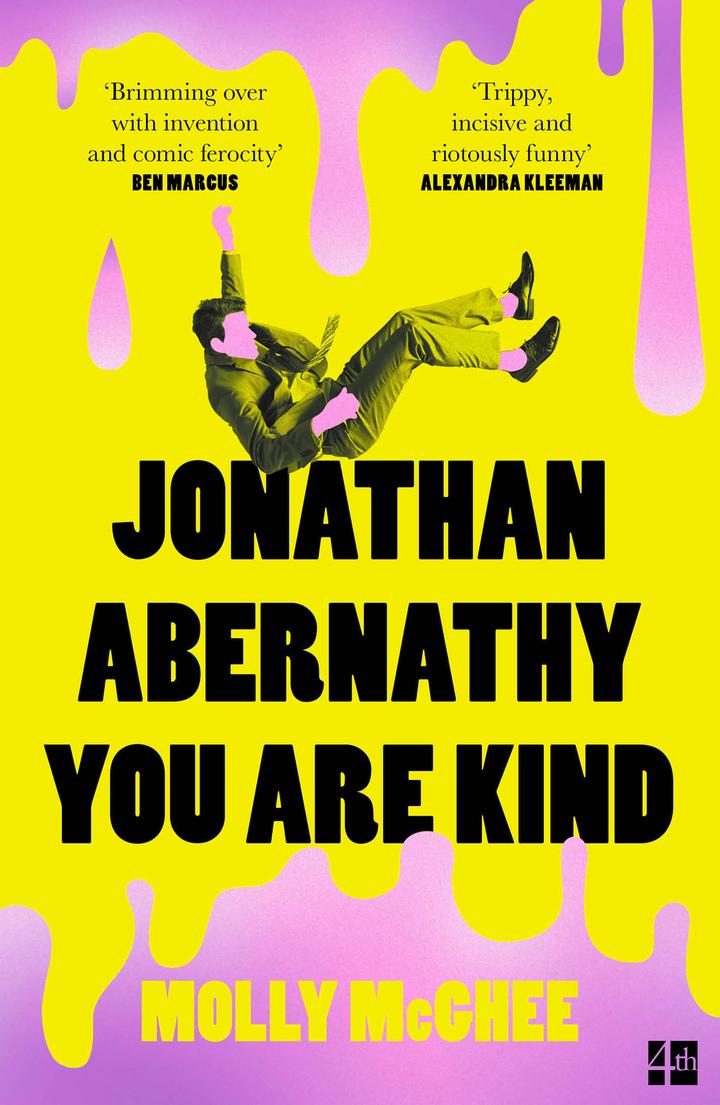
Jonathan Abernathy You Are Kind (Affiliate-Link)
Molly McGhee – Jonathan Abernathy You Are Kind (Satra House, 2023)
Die Zukunft gehört den Weirden. Oder wie anders ist es zu erklären, dass ausgerechnet die Generation der weltuntergangsgestimmten jungen Erwachsenen, zu denen Molly McGhee wohl noch zählen darf, eine so zarte wie menschenfreundliche und gänzlich unapokalyptisch daherkommende Zukunftsvision wie den Jonathan Abernathy hervorbringt? Im Debüt der in New York lehrenden und lebenden McGhee findet die Titelfigur – selbsterklärter Verlierer und gebeutelt von elterlichen Kreditkartenüberziehungen, „for profit“-universitären „Student Loan“-Zinseszinsen, die sich zu mittleren sechsstelligen Beträgen angehäuft haben – einen Weg aus einer Schuldendepression, die derart niederdrückt, dass er gar nicht erst versucht, eine Arbeit, eine Beziehung oder überhaupt ein selbstbestimmtes Leben anzufangen.
Es kommt in der Form eines halbstaatlich outgesourcten Jobangebots, das er nur zu freudig ergreift, und erst viel später erfährt, dass praktisch alle anderen mit dieser Berufsbeschreibung in den Job gezwungen wurden, oder ein Angebot bekamen, dass sie nicht ablehnen konnten, etwa als Kompensation oder Ersatz für eine Gefängnisstrafe. Dabei klingt es recht harmlos. Als Auditor soll er die Träume gestresster Büromenschen verfolgen und Anomalien detektieren, die auf produktivitätsrelevante Syndrome wie Depressionen oder posttraumatische Belastungsstörungen hinweisen. Mit der Option, später einmal dann zum Editor oder Kurator der Träume zu werden, die Traumata herauszuoperieren und den Menschen in nächtlicher Fremd-Selbstoptimierung einen erholsamen Schlaf und einen produktiven Arbeitstag zu ermöglichen – und sich selbst einen Daseinssinn und eine Aufgabe, vom behäbig dröppelnden Schuldenerlass mal abgesehen.
Auch klar, dass dieser offensiv naive Hans-im-Glück, der hier als einziger quasi freiwillig in die Traumwelten anderer tapert, damit in der Firma etwas auslöst. In gewisser Weise ist also auch der Jonathan Abernathy mal wieder eine Aktualisierung von Märchen, Mythen und Klassikern, wie sie seit geraumer Zeit trenden. Mehr noch ist er aber eine eher freundlich gestimmte, schnurrige Satire der spezifisch US-amerikanischen Bürokratie, des „Utopia der Regeln“, wie David Graeber sie nannte, eine mild-wilde Groteske mit einem Coming-Of-Age in Selbstaufgabe als Selbstverwirklichung. Traumarbeit im psychologischen wie im wörtlichen Sinn. Sogar beinahe ein Traumjob für einen, dessen größte Tugenden das Nichtserwarten, Nichtswollen und Nichtsbekommen sind.
Dieser Jonathan Abernathy ist einerseits extrem eigenwillig und nach innen gerichtet exzentrisch, wie Pessoas Hilfsbuchhalter Bernardo Soares oder Melvilles Bartleby, andererseits von einer unerschütterlich robusten Normalität, in zunehmend absurder werdenden Umständen also durchaus funktional. Im Lichte dieses sehr späten Spätkapitalismus, der hier spekuliert wird, also definitiv vernünftig.