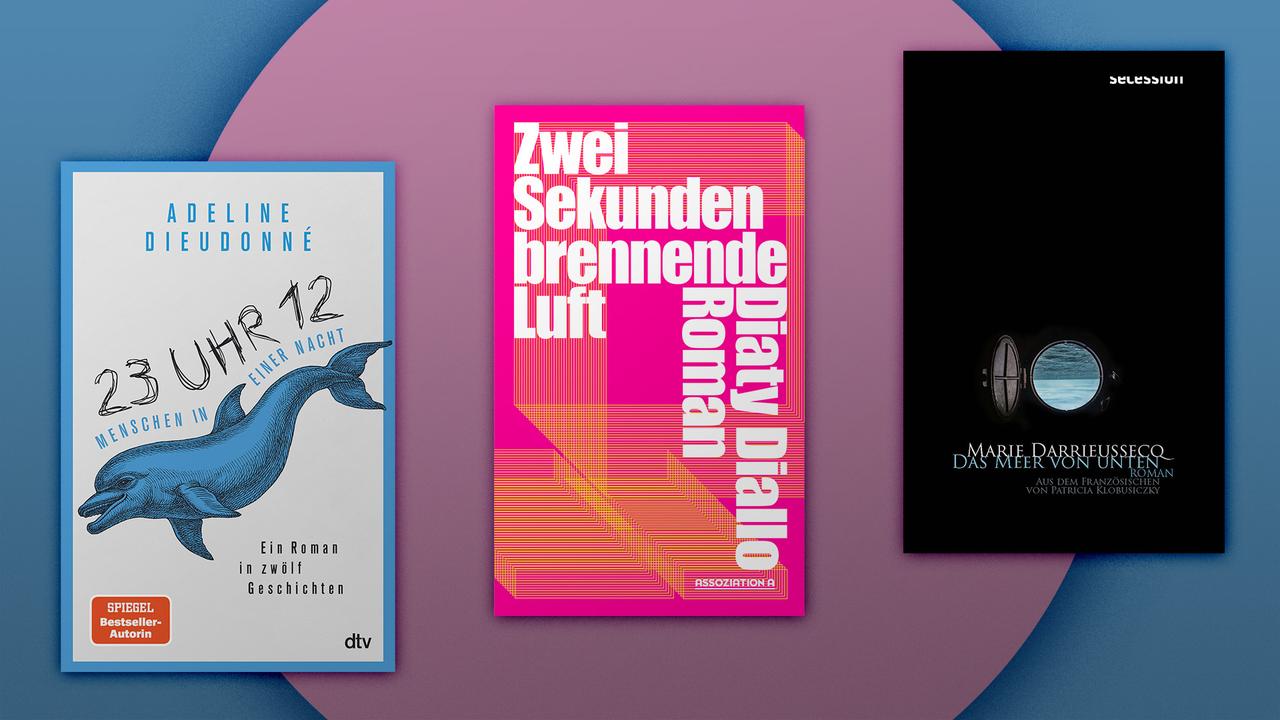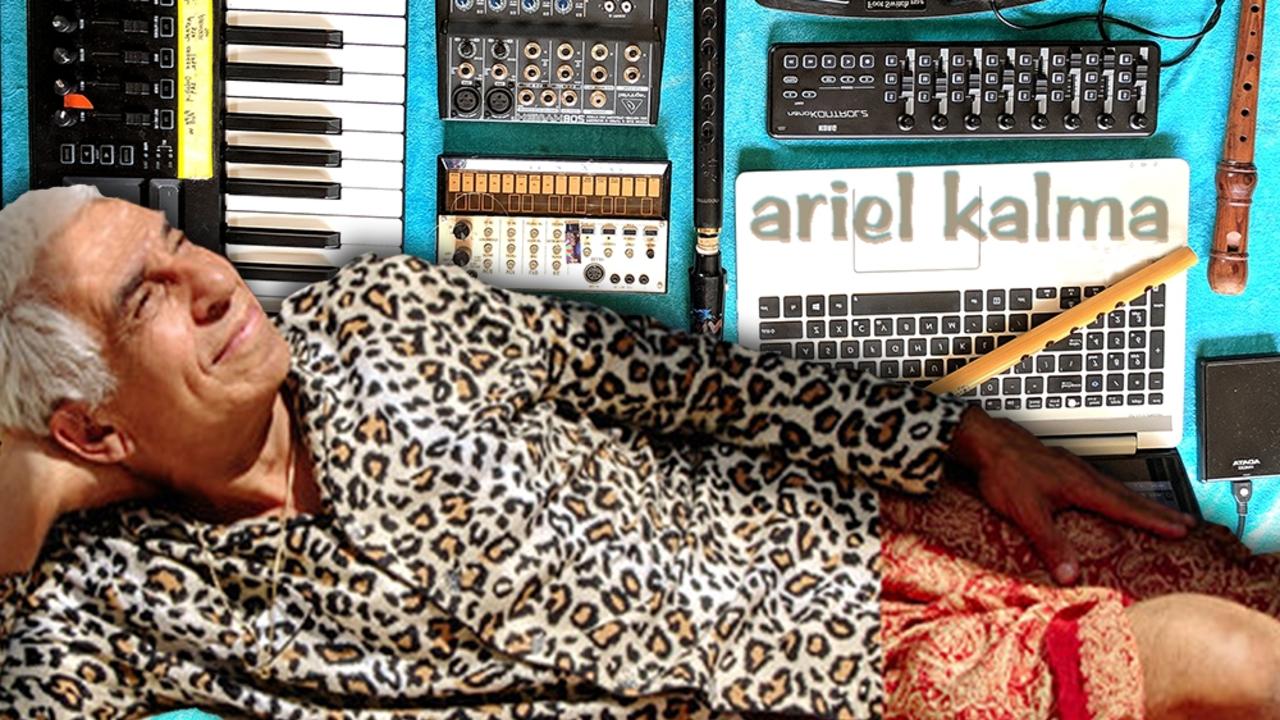„Kunst ist nicht dekorativ: Sie kann Verbindungen schaffen.“Laurens von Oswald vom Berlin Atonal im Interview
20.8.2025 • Kultur – Interview: Thaddeus Herrmann
Berlin Atonal 2023 im Kraftwerk | Foto: Helge Mundt
Das Festival Berlin Atonal steht für die geballte Kraft der experimentellen elektronischen Musik. Die diesjährige Ausgabe findet vom 27. bis zum 31. August statt. Mit rund 100 Konzerten, Perfomances, DJ-Sets und künstlerischen Interventionen ist Berlin Atonal nicht nur für Musikfans ein wichtiger Termin, sondern auch Beweis dafür, dass Berlin nach wie vor ein kultureller Leuchtturm abseits des Mainstreams ist. Wir haben im Vorfeld mit Laurens von Oswald gesprochen, der das Festival gemeinsam mit seinem Team seit 2013 betreut.
1982 fand das Berlin Atonal erstmals statt. Im Laissez-faire der Westberliner Schwebe brachte Dimitri Hegemann Musik und Musiker:innen auf die Bühne, bündelte deren Ideen und stellte sie zur Disposition. Die Mauerstadt bebte schon lange im DIY-Modus, mehr Aufmerksamkeit, mehr Internationalität war dringend nötig, um die durchsubventionierte Insel zu durchlüften. Nach dem Fall der Mauer und der Ankunft von Techno war Schluss. Hegemann eröffnete den Tresor, das Festival wurde auf Eis gelegt.
Seit 2013 ist das Berlin Atonal wieder zurück – mit neuem Team und einem musikalischen Konzept, das die zeitgenössische elektronische Musik in all ihren Facetten abbildet. Heimat des Festivals ist das Kraftwerk an der Köpenicker Straße, wo seit vielen Jahren auch der Tresor beheimatet ist. An der Spitze dieses Teams steht Laurens von Oswald. Er hat auch die 2025er-Ausgabe mit kuratiert. Das Line-up reicht von DJ-Sets von Calibre, Mala, Pinch, Skee Mask und Laurens’ Onkel Moritz von Oswald bis zu Konzerten und Performances von Amnesia Scanner, Emptyset, Merzbow, Purelink, Niecy Blues und John T. Gast. Fünf Tage lang folgt Highlight auf Highlight der elektronischen Musik, die nicht auf den mainstreamigen Dancefloor passt, und doch die Beats und Sounds der Zukunft abbildet.
Im Interview erklärt Laurens von Oswald, worum es ihm beim Berlin Atonal geht. Für was das Festival steht und für was nicht. Wie sich das alles rechnet und warum die Stadt Berlin die Kulturförderung neu ausrichten sollte. Dass das Festival nur noch alle zwei Jahre stattfindet, sollte allen zu denken geben.
Berlin Atonal hat als Festival Westberlin in den 1980er-Jahren geprägt – wenn natürlich auch in aller Bescheidenheit. 2013 kam dann der Neustart. Mit dir. Warum eigentlich?
Das war wirklich Zufall. Ich lernte Dimitri Hegemann kennen, der das Festival initiiert hatte. In dieser Zeit half ich meinem Onkel (Moritz von Oswald) im Studio und absolvierte ein Praktikum in der Booking-Agentur des Berghains. Dimitri zeigte mir das Kraftwerk. Das war 2012, ich war 23 Jahre alt. Das Kraftwerk war zu diesem Zeitpunkt halbwegs spielbereit. Dimitri fragte mich, ob ich Lust hätte, das Festival dort wieder zu beleben. Ich hatte keinerlei Erfahrungen in diesem Bereich, habe mich dann aber darauf eingelassen. Ohne wirkliche Vision, was wir machen wollten und wie sich der Ort bespielen lässt. Natürlich ging so ziemlich alles schief. Es war nicht durchdacht. Weil wir bestehende Formate in den Räumen umsetzen wollten. Wir machten aber weiter – unabhängig, mit Dimitris Segen. Stellten ein Team zusammen und machten uns Gedanken, was im Kraftwerk wirklich funktioniert, wie wir den Space nutzen können und wie er zur Leinwand für die unterschiedlichsten Arten von Kunst werden kann.
„Am Anfang steht immer die Frage: Was wollen wir beim Atonal begegnen? Und wie?“
Wie bedingt sich der Raum und die Musik? Und wo beginnt für euch das kuratorische Moment? Der Raum ist mächtig, dadurch aber auch klar gefärbt.
Die Kuration beginnt tatsächlich auch mit dem Raum selbst. Dort gibt keinerlei Infrastruktur, keine Bühne, keine PA. Er lässt sich also mehr oder weniger frei bespielen. Das hat für uns Konsequenzen, die sich nicht nur um das Booking als solches drehen, sondern auch das Festival-Phänomen in den Blick nehmen. Worum geht es bei Festivals? Auch immer reflektierend, was gerade in der Welt passiert. Dass wir mit Veranstaltungen wie dem Tomorrowland nichts gemein haben, ist klar. Aber selbst zum Dekmantel, wo die Bedeutung der zeitgenössischen elektronischen Musik ja verstanden wird, gibt es große Unterschiede. Am Anfang steht immer die Frage: Was wollen wir beim Atonal begegnen? Und wie? Wie können wir Kunst erlebbar machen abseits der Standards, die man ständig erleben kann, auf einem regulären Konzert an einem normalen Donnerstagabend. Das Kraftwerk bietet diese Möglichkeiten. Wir können andere Dinge anbieten, ganz anders mit den Künstler:innen in den Dialog treten. So können angedachte Projekte entweder realistisch kleiner werden oder eben noch größer. In der elektronischen Musik hat sich in den vergangenen Jahr im Performativen ja auch viel verändert: das klassische Laptop-Konzert zum Beispiel ist passé. Wir stellen bei der Kuration nicht nur die Frage nach dem Format der Performance, sondern auch nach dem Anschluss, nach Schnittmengen. Wie das in die Kunstwelt passt, zum Beispiel. Wie können wir Musik mit anderen Kunstformen kontrastieren oder zusammenbringen, also den Raum gestalten? Das Vertrauen, das uns dabei sowohl von den Künstler:innen als auch vom Publikum entgegengebracht wird, hilft uns natürlich.

Foto: Frankie Casillo
Wird diese Verzahnung vom Publikum wirklich angenommen, also wirklich gewertschätzt? Das Berlin Atonal läuft fünf Tage, das musikalische Angebot ist riesig. Bleibt da Zeit, nach links und rechts zu schauen?
Es geht um Aufmerksamkeit. Dieser Begriff ist wichtig. Tatsächlich sind ja Arten und Weisen, wie wir Kunst – damit meine ich alle Gewerke – wahrnehmen und konsumieren mehr oder weniger etabliert: von der Galerie bis zum Konzert. Für Konzerte kommen Menschen an einen bestimmten Ort, die Veranstaltungen haben einen Beginn und ein Ende. Bei anderen Kunstformen – zum Beispiel in einer Galerie – läuft es anders ab. Man kommt, geht wieder, kommt vielleicht wieder zurück. Ich finde es spannend, diese Ansätze zu verbinden. Kontexte zusammenzubringen, bestimmte Dinge im anderen Rahmen zu präsentieren. Und dann ist da natürlich noch die Nacht. Als zeitlicher Bereich ist die traditionell sehr wichtig, wenn es um Kreativität und sozialen Austausch geht. Ich finde aber, dass diese Idee nicht mehr diese exponierte Rolle spielt. Was in den Clubs passiert, ist mehr oder weniger überall gleich. Alles ist formatiert, man findet sich sofort zurecht. Das wollen wir anders machen. Was kann nach dem Konzert passieren? Welche Arten des hybriden Gemeinsamen sind vorstellbar? Und wie wirkt sich das auf die Arbeiten der Künstler:innen aus? Das interessiert uns: die Reibung, der Widerspruch. Da geht es nicht nur ums Tanzen.
Gesteuerte Balance.
Dabei geht es um den Kontext, die Art der Präsentation. Bei vielen Künstler:innen ist genau das Teil ihres Selbstverständnisses. Die wollen gar nicht immer das selbe machen. Ich beziehe mich dabei nicht ausschließlich auf Musiker:innen. Strukturen hinter sich lassen, die bestimmte und etablierte Modalitäten besetzen, das ist die Idee. Ich verstehe das Festival als eine Art von temporärem Container, in dem sich Dinge entfalten können. Das fühlt sich für jede Person anders an. Muss es auch und soll es auch. Das ist ja die Idee der Nacht. Die bei uns tatsächlich auch anders gelebt wird. Beim Atonal findet alles in einem Gebäudekomplex statt. Unterschiedliche Räume ergeben ein Ganzes. Von der großen Hallen über Tresor und Globus bis zum Ohm. Das Dazwischen ist interessant, und bietet viele Möglichkeiten, die andere Festivals, die an unterschiedlichen Locations stattfinden, nicht haben. Das ist fordernd für das Publikum und erfordert auch die Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Aber Kunst ist eben nicht dekorativ. Sie kann Verbindungen schaffen.

Laurens von Oswald | Foto: Christopher Bouchard
Das hat aber auch seinen Preis.
Total. Mir ist bewusst, dass die Tickets nicht günstig sind. Es ist eine Herausforderung, unseren Anspruch abzubilden und umzusetzen. 10.000 Menschen haben im Kraftwerk einfach keinen Platz, wir müssen penibel darauf achten, dass alles beherrschbar bleibt. Was die Ticketverkäufe angeht, haben wir das Maximum erreicht. Wir können dort nicht weiter wachsen. Das ist auch gut so. Nicht gut ist hingegen, dass das Line-up unter diesen Bedingungen eigentlich nicht finanzierbar ist, auch nicht für die 250 €, die der Festival-Pass kostet. Ich würde mir schon sehr gut überlegen, so viel Geld für eine Veranstaltung auszugeben. Das Land Berlin unterstützt uns, wir haben aber von der Kulturstiftung des Bundes deutlich mehr Geld bekommen, obwohl ein Festival wie unseres eigentlich gar nicht in die Förderbedingungen passt.
Ich bin ja nach wie vor davon überzeugt, dass unsere Veranstaltung nur in Berlin stattfinden kann. Der Raum ist einzigartig und nicht in den Händen von geldgierigen Menschen. Und natürlich sind auch viele Künstler:innen in der Stadt. Immer noch, muss man leider sagen, denn die Rahmenbedingungen haben sich ja dramatisch verändert. Berlin kümmert sich auf dem Weg zur Metropole nicht um das Besondere der Stadt. Das ist nicht das Überangebot an institutionellen Kultureinrichtungen. Was wunderbar ist, aber nicht das Alleinstellungsmerkmal Berlins: die Subkultur.
Der Raum für Experimente wird kleiner. Das macht mir Sorgen, gerade weil die Stadt mit der Subkultur ja wirbt.
Wir haben uns entschieden, auf einen zweijährlichen Rhythmus zu wechseln. Das gibt uns mehr Möglichkeiten zur Planung, aber auch, den transitären Charakter Berlins genau zu beobachten, der in der Kulturszene eine wichtige Rolle spielt. Das bedeutet nicht, dass wir in den Off-Jahren nicht aktiv sind. Aber ich empfinde es als wichtig, auch unser Format immer wieder zu hinterfragen und nicht die gesamte Energie darauf zu verwenden, nach dem Festival sofort und ausschließlich die nächste Ausgabe zu planen.
In der Berliner Subkultur gab es die geförderte Sicherheit ja ohnehin nie. Gehörte auch nie zum Selbstverständnis, eher im Gegenteil.
Das stimmt. Beweglichkeit muss Teil unseres Konzepts sein. Und passt auch in die Geschichte Berlins. Das kann auch motivierend sein. Wir möchten Leuchtturm sein und das, was Berlin ausmacht zusammenführen und erfahrbar machen. Mit dieser Idee sind wir natürlich nicht die Einzigen, sie ist aber wichtig. Denn die Welt hat immer noch einen besonderen Blick auf die Stadt. Aus guten Gründen: Ich wünsche mir, dass die Kultur, die wir präsentieren und kuratieren, gewertschätzt wird, dass die Strahlkraft erkannt wird. Die Wirkmacht zeigt sich ja exemplarisch, wenn Events in kleineren Städten stattfinden, wo sich Dinge nicht so versenden wie im großen Berliner Angebot. Das Fehlen von Strukturen hat so viel Power. Und das ist auch die Geschichte von Berlin. Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, die Welt ein bisschen auf den Kopf zu stellen.
Berlin Atonal, 27. bis 31. August, Kraftwerk Berlin. Line-up

Romeo Castellucci beim Berlin Atonal 2023 | Foto: Helge Mundt